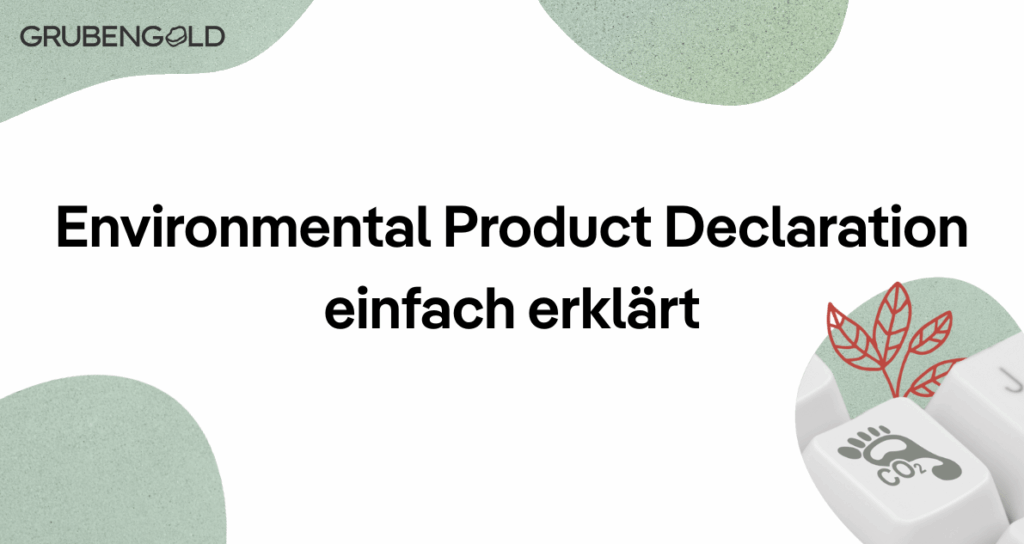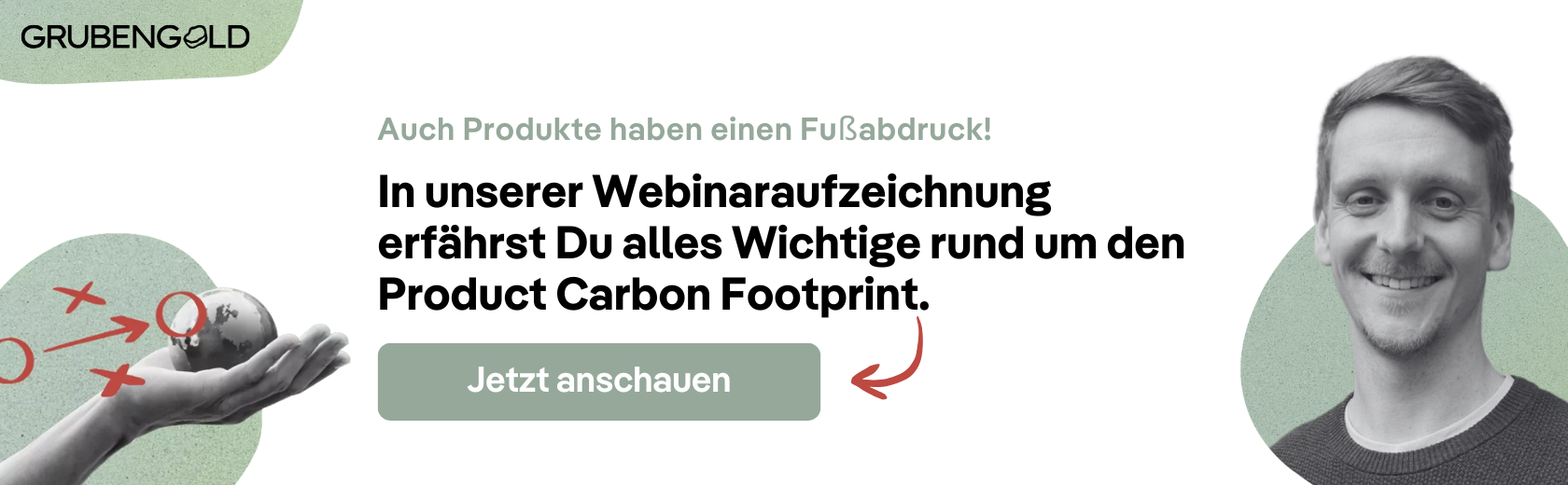Kurz erklärt – EPD verstehen in 60 Sekunden
Eine EPD (Environmental Product Declaration, deutsch: Umwelt-Produktdeklaration) ist ein standardisiertes Dokument, das die Umweltauswirkungen eines Produkts offenlegt.
–
Grundlage bildet eine Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA), die den gesamten Lebensweg betrachtet – von Rohstoffgewinnung und Produktion über Transport und Nutzung bis hin zu Recycling oder Entsorgung. Dabei werden zentrale Umweltfaktoren wie Energieverbrauch, CO₂-Emissionen, Wasserverbrauchund der Einfluss auf die Ozonschicht der Erde erfasst.
–
EPDs machen Nachhaltigkeit messbar, vergleichbar und transparent. Unternehmen gewinnen so eine belastbare Basis für Ausschreibungen, Investor:innenentscheidungen und Nachhaltigkeitsberichte.
–
Ziel ist es, Greenwashing zu vermeiden, fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und Produkte systematisch zu verbessern. Damit sind EPDs ein Schlüsselinstrument für zukunftsfähiges Wirtschaften und nachhaltige Kommunikation.
Nachhaltigkeit ist längst kein „Nice-to-have“ mehr – sie entscheidet über Aufträge, Investments und Marktchancen. Kund:innen, Partner:innen und Investor:innen erwarten von Euch heute klare Zahlen statt schöner Worte.
–
Und genau hier kommen EPDs (Environmental Product Declarations) ins Spiel. Eine EPD, auf Deutsch Umwelt-Produktdeklaration, zeigt transparent, wie sich ein Produkt über seinen gesamten Lebensweg hinweg auf die Umwelt auswirkt – von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Nutzung bis hin zum Recycling.
–
Im Bausektor gelten EPDs mittlerweile als Pflicht – dort ersetzen sie den reinen CO₂-Fußabdruck. Denn wo in anderen Branchen ein PCF genügt, fordern Bauzertifizierungen und öffentliche Ausschreibungen detaillierte Umwelt-Produktdeklarationen. Aber auch in anderen Branchen steigt der Druck: Textilien, Verpackungen oder Konsumgüter – überall fragen Kund:innen und Stakeholder nach Transparenz.
–
Also: Was steckt hinter einer EPD, was muss rein, was bringt sie Eurem Unternehmen – und wie läuft die Erstellung ab? Genau das klären wir jetzt.
Was ist eine EPD?
Eine EPD (Environmental Product Declaration) ist im Prinzip eine Öko-Performance-Visitenkarte für Eure Produkte. Sie basiert auf einer Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) und zeigt alle Umweltwirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Herstellung über die Nutzung bis zum „End of Life“.
–
Die Regeln dafür kommen aus den Normen ISO 14025 und EN 15804. Klingt sperrig, sorgt aber dafür, dass die Daten vergleichbar und belastbar sind.
Kurz erklärt
Was beinhaltet die ISO 14025?
Die DIN EN ISO 14025 – oft kurz ISO 14025 genannt – trägt den Titel „Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren“.
Sie bildet die Grundlage für sogenannte Typ-III-Umweltdeklarationen. Diese Norm beschreibt, wie solche Umweltdeklarationen und die dazugehörigen Programme entwickelt und umgesetzt werden sollen.
Dabei verweist sie besonders auf die Normenreihe DIN EN ISO 14040, die die Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) eines Produkts regelt.
Das Ziel ist, Produkte mit derselben Funktion anhand messbarer Umweltinformationen über ihren gesamten Lebenszyklus – also von der Herstellung bis zur Entsorgung – objektiv miteinander vergleichen zu können.
Was beinhaltet die EN 15804?
Die DIN EN 15804 – oft kurz EN 15804 genannt – trägt den Titel „Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte“.
Sie sorgt dafür, dass alle Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für Bauprodukte, Bauleistungen und Bauprozesse nach denselben Regeln erstellt, geprüft und dargestellt werden.
Die Norm legt dazu die grundlegenden Produktkategorie-Regeln fest (englisch: core Product Category Rules, kurz core PCR).
Mit Hilfe der EN 15804 sollen EPDs im Bausektor eine einheitliche Grundlage für die Beschreibung und Bewertung von Bauwerken bieten.
Damit konkretisiert die EN 15804 die Vorgaben der ISO 14025 speziell für Bauprodukte.
Was ist eine Lebenszyklusanalyse (LCA) oder Ökobilanz?
Eine Lebenszyklusanalyse (LCA) – auch Ökobilanz genannt – ist eine Methode, um die Umweltauswirkungen eines Produkts, einer Dienstleistung oder eines Prozesses über seinen gesamten Lebensweg zu bewerten. Sie betrachtet alle Phasen – von der Rohstoffgewinnung über Herstellung und Nutzung bis zur Entsorgung oder Wiederverwertung.
Dabei werden Ressourcenverbrauch, Emissionen und andere ökologische Folgen gemessen und bewertet. Ziel ist es, Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, etwa wenn man Produkte miteinander vergleichen will.
Die LCA konzentriert sich vor allem auf ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit, kann aber auch wirtschaftliche oder soziale Faktoren einbeziehen. Sie hilft, die wahre Umweltbelastung sichtbar zu machen und langfristig umweltbewusstere Entscheidungen zu ermöglichen.
Oft hört man auch den Begriff EPD Zertifikat. Streng genommen ist es kein Zertifikat im klassischen Sinne, sondern ein geprüfter Datensatz, der die Umwelteinflüsse Eures Produkts schwarz auf weiß zeigt. Trotzdem hat sich der Begriff eingebürgert – und signalisiert Kund:innen und Partner:innen sofort: Hier gibt es harte Fakten.
–
Beispiel: Zwei Dämmstoffe dämmen gleich gut. Aber nur mit einer EPD seht Ihr, welcher weniger CO₂ verursacht, wie viel Wasser verbraucht wird und ob er sich am Ende recyceln lässt. Genau diese Transparenz macht die EPD so wertvoll.
––
Kurz gesagt: Eine EPD Zertifizierung liefert Euch eine harte Währung im Nachhaltigkeitsmarketing – und verschafft Euch eine zusätzliche Argumentationsbasis in Verhandlungen mit Euren Kund:innen.
Was ist der Unterschied zwischen EPD und PCF?
EPD und PCF klingen ähnlich – beide beruhen auf einer Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, kurz: LCA). Trotzdem unterscheiden sie sich deutlich im Fokus, in der Datentiefe und im Einsatzbereich:
Aspekt
EPD (Environmental Product Declaration)
PCF (Product Carbon Footprint)
Regelwerk
ISO 14025 / EN 15804
ISO 14067
Schwerpunkt
Ganzheitliche Umweltwirkung
Treibhausgasemissionen (CO₂-Äquivalente)
Umfang
Betrachtet zahlreiche Umweltindikatoren: Energie- und Wasserverbrauch, Eutrophierung, Versauerung, Ozonabbau, Ressourcenverbrauch u. v. m. über den Lebenszyklus eines Produkts
Betrachtet ausschließlich die CO₂-Emissionen über den Lebenszyklus eines Produkts
Datenbasis
Beruht auf einer LCA, nutzt jedoch teils standardisierte Datensätze (z. B. aus Ökobau.dat oder ecoinvent) für schwer messbare Umweltwirkungen
Ebenfalls LCA-basiert, meist mit betriebsspezifisch erhobenen Daten
Zielsetzung
Nachweis der Umweltleistung, z. B. für Bauzertifizierungen und (öffentliche) Ausschreibungen
Quantifizierung des CO₂-Fußabdrucks zur internen Bewertung, Kommunikation an Kund:innen und für Ausschreibungen
Vorteil
Betrachtet alle relevanten Umweltaspekte – nicht nur CO₂
Liefert individuellere, betriebsnahe Ergebnisse und ist leichter zu berechnen
Nachteil
Da nicht alle Umweltwirkungen individuell messbar sind, greifen viele EPDs auf standardisierte Daten zurück – dadurch können einzelne Werte weniger spezifisch sein
Betrachtet nur CO₂, keine weiteren Umweltwirkungen
Ein Product Carbon Footprint (PCF) zeigt, wie viel CO₂ ein Produkt verursacht. Eine Environmental Product Declaration (EPD) geht weiter – sie zeigt zusätzlich, welche weiteren Umweltwirkungen ein Produkt hat, etwa wie stark es die Ozonschicht, Böden oder Gewässer belastet.
_
Beide Ansätze ergänzen sich: Der PCF ist ideal für Klimabilanzierung und Kommunikation, die EPD ist der etablierte Nachweis im Bausektor – dort, wo Nachhaltigkeit umfassend und vergleichbar dokumentiert werden muss.
Sind EPDs verpflichtend?
Eine harte gesetzliche Pflicht gibt es (noch) nicht. Aber in vielen Fällen sind EPDs faktisch unverzichtbar:
- In der Bauproduktenverordnung (EU 305/2011) können EPDs als offizieller Nachweis dienen.
- Die EU-Taxonomie fordert Transparenz, um Greenwashing auszuschließen. Eine EPD bietet dafür eine verlässliche und standardisierte Grundlage, während ein PCF meist nur Teilaspekte abdeckt.
- Alle gängigen Gebäudezertifizierungen (DGNB, LEED, BREEAM, ÖGNB, BNB) verlangen EPD-Daten.
- In der öffentlichen Beschaffung sind EPDs immer öfter ein Muss.
–
Dazu kommt: Auch Investor:innen und Banken erwarten zunehmend Nachweise in Sachen Nachhaltigkeit. Wer Bauprojekte finanziert oder Immobilienfonds auflegt, braucht belastbare Daten – und eine EPD ist hier Gold wert.
–
International gilt: In Ländern wie Frankreich oder den nordischen Staaten sind EPDs teilweise bereits Pflicht bei öffentlichen Bauprojekten. Der Trend zeigt klar: Die Frage ist nicht, ob EPDs verpflichtend werden, sondern nur, wann und in welchem Umfang.
–
Besonders für EPD Bauprodukte (wie Dämmstoffe, Beton, Stahl) gilt: Wer heute Baustoffe verkaufen will, braucht eine EPD – sonst wird’s schwierig, konkurrenzfähig zu bleiben. Investor:innen und öffentliche Auftraggeber:innen erwarten diesen Nachweis längst standardmäßig.
Was muss in einer EPD stehen?
Eine EPD geht weit über „CO₂-Emissionen pro Produkt“ hinaus. Sie beleuchtet alle relevanten Umweltfaktoren und macht sichtbar, wie ein Produkt über den gesamten Lebensweg wirkt.
Verwendung von Ressourcen
Zunächst wird der Ressourcenverbrauch betrachtet: Welche Primärenergie wird eingesetzt – erneuerbar wie Holz oder Wasserkraft, oder nicht-erneuerbar wie Erdgas und Öl? Dazu kommt der Anteil an Recycling-Materialien und Sekundärbrennstoffen sowie der Verbrauch von Süßwasser.
Umwelteinwirkungen des Produkts
Ein zweiter Block sind die Umweltwirkungen. Hier zeigt die EPD, welchen Beitrag ein Produkt zum Klimawandel leistet (GWP – Global Warming Potential), wie stark es zur Bildung von saurem Regen beiträgt (AP – Acidification Potential), ob es Böden und Gewässer durch Nährstoffe belastet (EP – Eutrophication Potential), in welchem Maß es die Ozonschicht schädigt (ODP – Ozone Depletion Potential) oder ob es Smog verursacht (POCP – Photochemical Ozone Creation Potential).
Regelungen zu Recycling & Abfallentsorgung
Und schließlich geht es um Abfall und Recycling: Wie viel gefährlicher oder ungefährlicher Abfall entsteht? Welche Mengen lassen sich recyceln oder wiederverwenden? Welche Teile werden thermisch verwertet und liefern sogar noch Energie zurück?
Ein Beispiel macht das greifbar: Ein Ziegel braucht zwar viel Energie bei der Herstellung, lässt sich am Ende seines Lebenszyklus aber recyceln. Ein Dämmstoff spart in der Produktion Energie, ist dafür in der Entsorgung oft komplizierter.
Wie erstellt man eine EPD?
Eine EPD fällt nicht einfach so vom Himmel. Sie ist das Ergebnis eines klar strukturierten Prozesses, bei dem verschiedene Akteur:innen zusammenspielen: Hersteller, Beratungsstellen, unabhängige Prüfer:innen und Programmbetreiber. Ziel ist es, am Ende ein Dokument zu haben, das wirklich belastbare und vergleichbare Daten liefert – und genau deshalb auch international anerkannt ist.
–
Für Euer Unternehmen bedeutet das: Die Erstellung einer Environmental Product Declaration ist zwar mit Aufwand verbunden, aber absolut machbar, wenn man die Schritte kennt. Und die sehen so aus:
Lebenszyklusanalyse (Datensammlung & Berechnung)
Am Anfang steht die Bestandsaufnahme. Hier wird eine Ökobilanz über den gesamten Lebenszyklus erstellt – also von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Transport bis hin zur Nutzung und Entsorgung. Alle Stoff- und Energieströme werden erfasst, quantifiziert und in Umweltwirkungen übersetzt. Diese Basisarbeit ist entscheidend, denn nur mit sauberen Daten wird die spätere EPD belastbar.
Erstellung durch Unternehmen oder Beratungsstelle
Auf Grundlage der LCA werden die Ergebnisse in eine standardisierte Form gebracht: die eigentliche EPD. Das könnt Ihr intern machen – oder Ihr holt Euch Unterstützung von einer spezialisierten Beratungsstelle. Programmbetreiber wie das Institut Bauen und Umwelt (IBU), die ev IBU oder die Bau-EPD GmbH koordinieren den Prozess nach den geltenden Normen und stellen die Einbindung unabhängiger Verifizierer:innen sicher, die die EPD auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen.
Prüfung durch unabhängige Dritte
Damit aus den Daten ein glaubwürdiger Nachweis wird, braucht es die unabhängige Prüfung. Hier kommt ein externer Verifizierer ins Spiel, der kontrolliert, ob Methodik und Ergebnisse stimmen. Erst nach der unabhängigen Verifizierung durch Dritte gilt die EPD als offiziell bestätigt – man spricht dann oft umgangssprachlich von einer „EPD-Zertifizierung“, auch wenn technisch die EPD selbst verifiziert wird, nicht das Produkt.
Veröffentlichung im EPD-Register
Zum Schluss geht es um die Sichtbarkeit. Die geprüfte EPD wird in einem offiziellen EPD Programm veröffentlicht, zum Beispiel im IBU-Register, im DGNB Navigator oder auf der ECO Platform. Ab diesem Moment ist Eure Umwelt-Produktdeklaration für Architekt:innen, Planer:innen, Bauunternehmen und Investor:innen zugänglich – und kann als Nachweis in Projekten, Ausschreibungen oder Zertifizierungen genutzt werden.
Auch hier ein Praxisbeispiel: Ein Dämmstoffhersteller, der seine Produkte im DGNB Navigator listen lässt, verschafft sich sofort einen Vorteil – Architekt:innen können direkt sehen, wie nachhaltig das Produkt ist, und greifen eher darauf zurück.
Welche Arten von EPDs gibt es?
Nicht jede EPD ist gleich. Abhängig davon, wie detailliert die Daten sind und für wen die Erklärung gedacht ist, unterscheidet man mehrere Typen. Diese Kategorien sind in der Praxis durch Programmbetreiber wie das Institut Bauen und Umwelt (IBU) etabliert. Sie orientieren sich an den Grundprinzipien der ISO 14025 und EN 15804, sind aber nicht direkt in den Normen selbst festgelegt.
Spezifische EPD
Das ist die Königsklasse: Sie bezieht sich auf ein konkretes Produkt eines Herstellers – inklusive werksspezifischer Daten. Beispiel: Ein Ziegelstein, der genau in Werk X produziert wurde. Für Euch als Hersteller ist das die glaubwürdigste und individuellste Form, weil sie die Umweltperformance Eures Produkts genau zeigt.
Durchschnitts-EPD
Hier werden mehrere ähnliche Produkte zusammengefasst und ein Mittelwert gebildet. So eine „Average EPD“ wird oft genutzt, wenn es viele Varianten gibt, aber nicht jedes einzelne Produkt separat bilanziert werden soll. Für Kund:innen heißt das: Ihr bekommt ein realistisches Bild der gesamten Produktgruppe, aber eben keinen exakten Einzelwert.
Repräsentative EPD
Bei dieser Variante steht ein Beispielprodukt für die ganze Gruppe. Heißt: Ihr wählt ein Produkt aus, das typisch ist, und nehmt es als Stellvertreter. Gerade in Branchen mit vielen vergleichbaren Produkten ist das eine pragmatische Lösung – es spart Aufwand und liefert trotzdem eine solide Orientierung.
Muster-EPD
Das ist die allgemeinste Form. Hier fließen Daten mehrerer Hersteller ein, manchmal sogar Worst-Case-Szenarien. Eine Muster-EPD gibt also einen Orientierungswert für eine ganze Branche oder Produktgruppe, ohne die Umweltwirkung eines einzelnen Herstellers im Detail darzustellen.
–
In Deutschland sind Muster-EPDs nach wie vor weit verbreitet, weil sie für Branchen und Verbände schnell umsetzbar sind. Doch die Entwicklung geht klar in eine andere Richtung: Spezifische EPDs gelten heute in vielen Bereichen als neuer Standard – insbesondere dort, wo Produkte im direkten Wettbewerb stehen oder Nachhaltigkeitsnachweise Teil von Ausschreibungen und Zertifizierungen sind.
–
Für Euer Unternehmen bedeutet das: Eine spezifische EPD ist mehr als nur ein Nachweis – sie ist ein echtes Qualitätsmerkmal. Sie zeigt schwarz auf weiß, wie nachhaltig genau Euer Produkt ist und verschafft Euch damit einen klaren Vorteil bei Investor:innen, Kund:innen und in der öffentlichen Beschaffung.
Wer darf eine EPD erstellen?
Grundsätzlich Ihr als Hersteller (Produktinhaber). Aber: Ohne die Verifizierung durch unabhängige Dritte läuft nichts. In der Praxis übernehmen Hersteller oder spezialisierte Beratungsstellen (LCA-Dienstleister) die Erstellung und Abstimmung der EPD. Programmbetreiber wie das Institut Bauen und Umwelt (IBU) definieren die zugrunde liegenden Regeln (Product Category Rules), organisieren das Verifizierungsverfahren und veröffentlichen die geprüfte EPD im offiziellen Register.
Wie hoch sind die Kosten für eine EPD?
Die Frage nach den Kosten kommt fast immer als Erstes – und die Antwort lautet: Es kommt darauf an. Der Aufwand hängt stark von der Produktkomplexität, der Datenlage und dem gewählten Programmbetreiber ab.
–
Grundsätzlich entstehen drei Kostenblöcke:
- Erstellung und Lebenszyklusanalyse (LCA):
Die eigentliche Datenerhebung und Berechnung liegt je nach Produkt zwischen etwa 3.500 € und 13.500 €.
Je mehr Primärdaten Ihr selbst liefern könnt, desto geringer fallen Aufwand und externe Kosten aus. - Verifizierung durch unabhängige Dritte:
Für die Prüfung und Freigabe durch akkreditierte Verifizierer:innen kommen in der Regel 1.500 – 2.500 € hinzu. - Registrierung und Veröffentlichung:
Programmbetreiber wie das Institut Bauen und Umwelt (IBU) oder EPD International AB erheben zusätzliche Gebühren für die Eintragung und Veröffentlichung im EPD-Register – häufig einmalig plus jährliche Pauschalen.
–
Insgesamt liegen die Kosten für eine vollständige, verifizierte EPD meist im mittleren fünfstelligen Bereich.
–
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kann das erstmal nach einer hohen Hürde klingen. Aber es gibt Fördermöglichkeiten und Programme, die speziell KMU beim Einstieg in die EPD unterstützen. Wichtig ist: Eine EPD ist keine reine Kostenstelle – sie ist eine Investition, die Euch Türen öffnet.
Wie lange dauert die Erstellung einer EPD?
Auch hier gilt: Die Dauer hängt stark von Eurer Vorbereitung ab. Je besser Ihr Eure Wertschöpfungskette und Materialflüsse kennt, desto schneller lässt sich die LCA aufsetzen – unabhängig davon, dass viele Umweltwirkungen auf Datenbankwerten basieren. Für eine Screening-EPD, also eine vereinfachte Version, reichen oft ein paar Wochen.
–
Eine vollständige EPD, einschließlich der unabhängigen Verifizierung durch Dritte, dauert in der Regel drei bis sechs Monate – abhängig von Produktkomplexität, Abstimmungsaufwand und Programmbetreiber.
–
Der Knackpunkt ist fast immer die Datenqualität. Je sauberer Ihr Eure Produktions- und Lieferketten-Daten dokumentiert, desto reibungsloser läuft der Prozess.
Was sind die Vorteile einer EPD?
Wie bereits geschrieben, ist eine EPD nicht nur Arbeit und ein weiterer Kostenpunkt, sondern sie kann euch echte Vorteile bringen:
- Transparenz: Ihr zeigt schwarz auf weiß, wie nachhaltig Eure Produkte wirklich sind – und lasst Greenwashing gar nicht erst aufkommen.
- Vergleichbarkeit: Mit einer EPD könnt Ihr Eure Produkte fair mit Wettbewerber:innen vergleichen – und Euch durch bessere Werte abheben.
Wettbewerbsvorteil: Ob Ausschreibungen, Zertifizierungen oder Investor:innengespräche – mit einer EPD habt Ihr ein starkes Argument auf Eurer Seite. - Produktoptimierung: Die Analyse zeigt Euch Hotspots im Lebenszyklus. Damit habt Ihr die Chance, Kosten zu sparen, Prozesse zu verbessern und Emissionen zu senken.
- Marketing-Power: Eine EPD ist ein starker Hebel in der Nachhaltigkeitskommunikation – für Eure Website, Vertriebsunterlagen oder Gespräche mit Investor:innen.
–
Dazu kommt: Eine EPD stärkt nicht nur Eure externe Kommunikation, sondern wirkt auch intern. Ihr gewinnt ein tieferes Verständnis für die eigenen Prozesse, erkennt Ineffizienzen und schafft eine solide Datenbasis für weitere Nachhaltigkeitsberichte.
–
Viele Daten, die für eine EPD benötigt werden, stammen aus der Erstellung des Corporate Carbon Footprint (CCF) – etwa Energieverbräuche oder Materialeinsätze. Umgekehrt liefert die EPD wertvolle Einblicke in Scope-3-Emissionen und kann so als Grundlage für CSRD-Berichterstattung oder SBTi-Ziele dienen.
Welche Herausforderungen gibt es bei einer EPD?
Natürlich hat eine EPD auch ihre Stolpersteine:
- Aufwand: Die Datensammlung ist komplex, vor allem wenn viele Zulieferer involviert sind.
- Kosten: Für kleinere Unternehmen kann die Investition eine Hürde sein.
- Komplexität: Die Methodik nach ISO 14025 und EN 15804 ist anspruchsvoll und erfordert Fachwissen.
- Update-Zyklus: Eine EPD ist kein einmaliges Projekt. In der Regel muss sie alle 5 Jahre aktualisiert werden, um gültig zu bleiben.
Wie Grubengold Dich bei der EPD unterstützt
Wir wissen: Eine EPD klingt erstmal nach viel Papierkram und Aufwand. Aber mit dem richtigen Partner wird’s machbar – und für Euer Unternehmen ein echter Gamechanger.
–
Wir begleiten Euch von A bis Z:
- Wir erstellen die Lebenszyklusanalyse (LCA) nach ISO 14025 und EN 15804 – gemeinsam mit unseren Partner:innen aus der Praxis.
- Wir unterstützen Euch bei der Datensammlung und -aufbereitung und gleichen die Werte mit relevanten Branchendaten ab, damit die Ergebnisse belastbar und vergleichbar sind.
- Wir helfen Euch bei der Kommunikation und Vermarktung, damit Eure EPD nicht nur ein Pflichtdokument bleibt, sondern als strategisches Asset echten Mehrwert schafft – in Ausschreibungen, im Vertrieb und für Eure Nachhaltigkeitskommunikation.
–
Unser Anspruch: Wir übersetzen komplexe Anforderungen in klare Prozesse. Statt Euch mit Normendetails allein zu lassen, holen wir Euch dort ab, wo Ihr steht – ob als mittelständisches Unternehmen, das zum ersten Mal eine EPD braucht, oder als Konzern, der sein Portfolio systematisch umstellen will.
–
Das Ergebnis: Ihr erfüllt nicht nur alle Anforderungen, sondern könnt Nachhaltigkeit auch sichtbar, glaubwürdig und erfolgreich nach außen tragen.
Unser Experte

David Hannes
David unterstützt Unternehmen u. a. bei den Themen CO₂-Bilanzen und nachhaltige Geschäftsmodell-Transformation. Mit seinem naturwissenschaftlichen Hintergrund als Medizinphysiker – inklusive eines Auslandssemesters am MIT – bringt er analytische Tiefe und systemisches Denken in die Entwicklung von Klimastrategien ein. Bei Grubengold berät er Unternehmen dabei, Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu bilanzieren, zu verstehen und wirkungsvoll zu reduzieren.