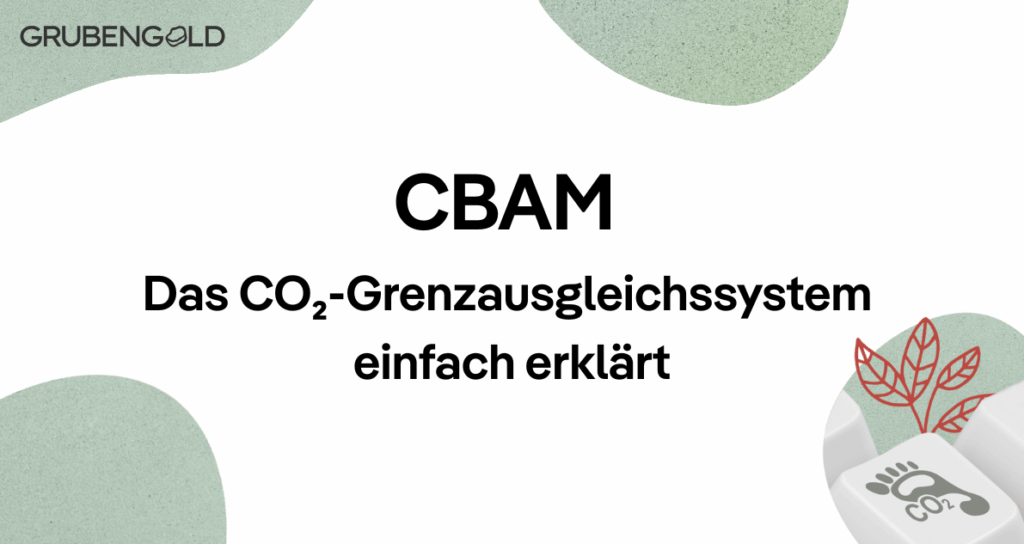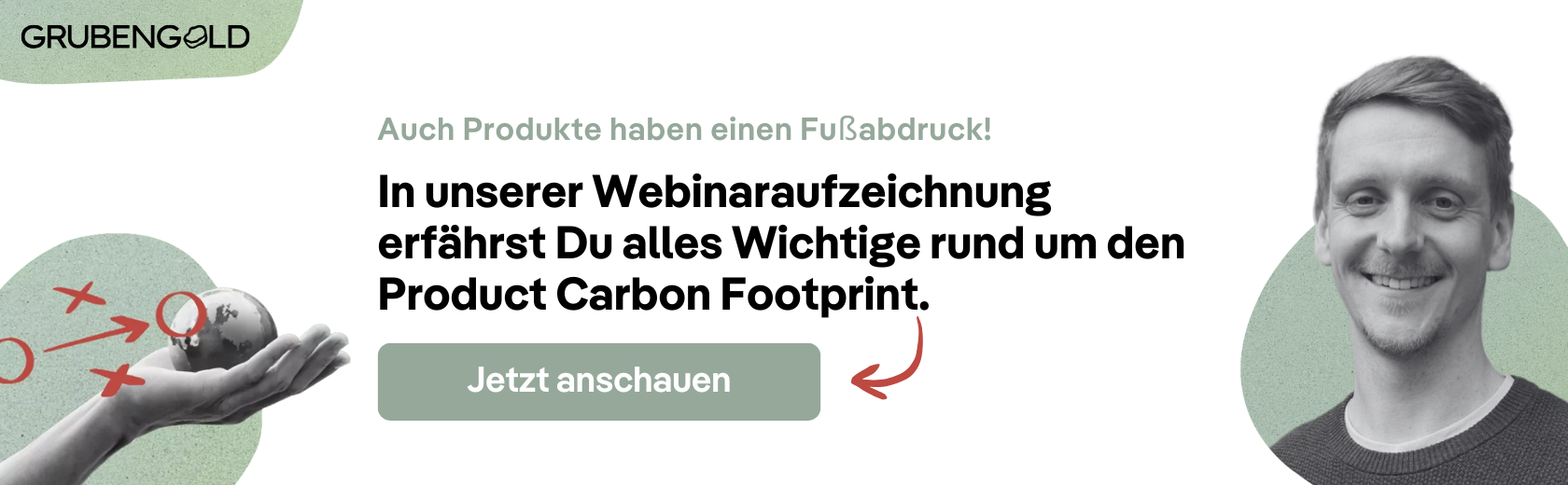Kurz erklärt – CBAM in 60 Sekunden
🌍 Was genau ist CBAM?
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ist das neue CO₂-Grenzausgleichssystem der EU, das Importeure verpflichtet, für die bei der Herstellung ihrer Waren außerhalb der EU entstandenen Emissionen CO₂-Zertifikate zu kaufen.
🏗️ Welche Produkte sind betroffen?
In der Übergangsphase betrifft CBAM besonders emissionsintensive Produkte wie Eisen und Stahl, Zement, Aluminium, Düngemittel, Elektrizität und Wasserstoff; künftig könnten auch Chemikalien und Kunststoffe folgen.
⚖️ Welche Ausnahmen gibt es bzw. wann ist man nicht betroffen?
Ausgenommen sind Importe aus Ländern mit einem gleichwertigen Emissionshandelssystem wie Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz sowie ab 2026 Kleinimporteure mit weniger als 50 Tonnen CBAM-Waren pro Jahr.
CBAM einfach erklärt
CBAM klingt erstmal nach komplizierter EU-Bürokratie. Aber dieses System betrifft vielleicht bald direkt Euer Unternehmen. Seit Oktober 2023 läuft die Übergangsphase. Ab dem 1. Januar 2026 beginnt die sogenannte Implementierungs- und Bepreisungsphase: Dann müssen für bestimmte Waren, die außerhalb der EU produziert werden, beim Import CO₂-Zertifikate gekauft werden.
–
Dieser Mechanismus – offiziell Carbon Border Adjustment Mechanism (kurz: CBAM) – soll verhindern, dass klimaschädlich produzierte Güter aus Drittstaaten preisliche Vorteile gegenüber europäischen Produkten haben. Denn innerhalb der EU müssen Unternehmen schon heute Emissionszertifikate erwerben, wenn sie fossile Brennstoffe einsetzen.
–
Gerade Branchen wie die Stahlindustrie stehen hier unter Druck: Solange es keine vollständig klimaneutralen Produktionsverfahren gibt, droht ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Ländern mit niedrigen oder gar keinen CO₂-Preisen. CBAM gleicht diesen Unterschied aus – und sorgt dafür, dass Emissionen überall ihren Preis haben.
–
Viele Unternehmen stellen sich deshalb gerade die Frage: Lohnt es sich noch, bestimmte Produkte zu importieren – oder ist es langfristig günstiger und strategisch klüger, sie selbst in der EU herzustellen? Genau hier setzt CBAM an: Es macht Emissionen überall vergleichbar und sorgt dafür, dass klimaschädliche Produktion keinen Kostenvorteil mehr hat.
Was versteht man unter CBAM?
CBAM steht für Carbon Border Adjustment Mechanism, auf Deutsch CO₂-Grenzausgleichssystem. Im Kern ist es ein neues Klimaschutzinstrument der EU, das wie eine Art „CO₂-Zoll“ funktioniert.
–
Innerhalb der EU gilt der europäische Emissionshandel (EU-ETS) für große, energieintensive Anlagen – etwa Kraftwerke, Raffinerien, Stahl- und Zementwerke. Sie müssen Emissionszertifikate für den Einsatz fossiler Brennstoffe erwerben. Das System macht CO₂-intensive Produkte teurer und soll als marktwirtschaftlicher Anreiz zur Dekarbonisierung wirken.
–
Daneben existieren nationale Systeme wie das deutsche Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). Ab 2027 wird mit dem EU-ETS 2 ein zusätzliches, europaweites System für Gebäude und Verkehr eingeführt.
–
Produzenten außerhalb der EU zahlen bislang oft wenig oder gar nichts für ihren CO₂-Ausstoß. Zwar gibt es in einigen Ländern – etwa in China oder Kanada – eigene CO₂-Preissysteme, doch deren Kosten liegen weit unter dem europäischen Niveau. So konnten Produzenten ihre Produkte oft günstiger in die EU exportieren, obwohl die Produktion mit hohen Emissionen verbunden war. Dieses Ungleichgewicht will die EU beenden. Mit CBAM werden importierte Produkte so behandelt, als wären sie innerhalb der EU entstanden. Für den CO₂-Ausstoß beim Import müssen dann CBAM-Zertifikate gekauft werden, deren Preis sich am EU-Emissionshandel orientiert.
–
Damit schließt CBAM die Lücke, die man bisher als Carbon Leakage bezeichnet. Manche sprechen deshalb auch von einer europäischen Carbon Tax, genauer gesagt von einer EU Carbon Border Tax. Der Begriff ist zwar nicht offiziell, macht aber klar, dass es sich um eine Form von Carbon Border Adjustment handelt – in vielen Medien findest Du CBAM auch unter den Bezeichnungen Carbon Border Tax, Border Adjustment Tax oder CO₂-Grenzausgleich Mechanismus.
Welche Produkte sind von CBAM betroffen?
Seit dem 1. Oktober 2023 gilt CBAM in einer Übergangsphase für bestimmte Güter, die besonders emissionsintensiv sind. Dazu gehören Eisen und Stahl, Zement, Aluminium, Düngemittel, Elektrizität und Wasserstoff. Gerade in diesen Branchen entstehen viele Emissionen, weshalb die EU hier ansetzt.
–
Wenn Euer Unternehmen also beispielsweise Stahl aus China, Zement aus der Türkei oder Aluminium aus Indien importiert, musst Du schon heute Daten melden. Dabei geht es nicht nur um die Menge, sondern auch um die konkreten Emissionen, die bei der Herstellung angefallen sind. Genau das stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen: Die Emissionsdaten müssen bei den Lieferanten abgefragt werden – und die Angaben können je nach Produktionsstandort stark voneinander abweichen. Eine Plausibilitätsprüfung ist oft aufwändig und schwer nachvollziehbar.
–
Die EU hat außerdem signalisiert, dass CBAM in den kommenden Jahren ausgeweitet werden könnte. Diskutiert wird die Einbeziehung von Chemikalien, Kunststoffen oder weiteren Rohstoffen. Für Unternehmen bedeutet das: Auch wenn Euer Unternehmen heute noch nicht betroffen ist, solltest Du die CBAM auf dem Radar haben.
Was ist die neue Freigrenze für CBAM-Waren?
Eine klare Tonnengrenze, unterhalb derer CBAM komplett entfällt, gibt es nicht. In der Übergangsphase (2023–2025) gilt jedoch eine Erleichterung: Unternehmen, die weniger als 50 Tonnen CBAM-Waren pro Jahr importieren, dürfen vereinfachte Methoden zur Emissionsberechnung anwenden – sind aber weiterhin berichtspflichtig. Auch kleine Importeure sind verpflichtet, Berichte einzureichen, sobald sie betroffene Waren in die EU einführen.
–
Allerdings enthält die CBAM-Verordnung (Artikel 2 Absatz 3) eine sogenannte de-minimis-Regel vor: Waren mit einem Gesamtwert von weniger als 150 Euro pro Sendung fallen nicht unter die CBAM-Pflichten. Diese Regel erleichtert den Kleinstimport, ersetzt aber keine echte Freigrenze für Unternehmen, die regelmäßig größere Mengen importieren.
–
Für Euer Unternehmen bedeutet das: Rechne damit, dass jede relevante Einfuhr erfasst werden muss. Verlass Dich nicht auf Ausnahmen.
Wer muss CBAM melden?
Die Hauptverantwortung liegt beim Importeur – also bei dem Unternehmen, das die Zollanmeldung abgibt. Laut Artikel 32 und 33 der CBAM-Verordnung kann diese Pflicht jedoch an einen indirekten Zollvertreter übertragen werden, wenn der Importeur außerhalb der EU ansässig ist. Für in der EU ansässige Unternehmen gilt: Sie sind selbst primär verpflichtet, die CBAM-Berichte einzureichen. Wenn Euer Unternehmen Waren offiziell in die EU einführt, seid Ihr die Stelle, die CBAM-Berichte abgeben muss.
–
Gerade bei komplexen Lieferketten kann es passieren, dass unklar ist, wer rechtlich Importeur ist. Diese Rolle solltest Du unbedingt prüfen. Denn nur der Importeur ist rechtlich verpflichtet, die CBAM-Berichte einzureichen und später die Zertifikate zu kaufen. Diese Verantwortung kann nicht einfach durch einen Vertrag auf Lieferanten oder Partner:innen übertragen werden.
–
Wichtig ist jedoch: Die Pflicht zur Datenlieferung muss vertraglich an die Lieferanten weitergegeben werden – denn nur sie verfügen über die notwendigen Informationen zu den Emissionen der Produktionsanlagen. Ohne diese Daten kann der Importeur seine eigenen Pflichten nicht erfüllen.
–
Für Dich bedeutet das: Wenn Ihr importiert, seid Ihr in der Verantwortung. Es lohnt sich, intern genau zu klären, wer die Meldungen erstellt und welche Abteilungen die nötigen Daten liefern.
Wie meldet man CBAM?
Seit Oktober 2023 läuft die Übergangsphase, die bis Ende 2025 gilt. In dieser Zeit musst Du quartalsweise CBAM-Berichte einreichen. Darin dokumentierst Du, welche Mengen Euer Unternehmen importiert hat, welche Emissionen bei der Herstellung entstanden sind und ob im Herkunftsland bereits CO₂-Preise gezahlt wurden. Diese können angerechnet werden, damit es nicht zu einer Doppelbepreisung kommt – vorausgesetzt, Du kannst die entsprechenden Nachweise vorlegen.
–
Wichtig ist dabei: In der Übergangsphase unterscheiden sich die Berichtspflichten nach Sektoren. Für Zement und Düngemittel musst Du sowohl direkte als auch indirekte Emissionen melden. Für Eisen, Stahl, Aluminium, Elektrizität und Wasserstoff sind zunächst nur die direkten Emissionen relevant. Ab 2026 werden die Anforderungen für alle Sektoren strenger.
–
Ab dem 1. Januar 2026 startet das endgültige System. Dann musst Du Euer Unternehmen als „authorised CBAM declarant“ registrieren. Für Eure Importe reicht es nicht mehr, nur Berichte zu erstellen: Du musst CBAM-Zertifikate kaufen, die den eingebetteten Emissionen entsprechen. Der Preis richtet sich direkt nach dem EU-Emissionshandel. Alle Abläufe laufen ab dann über ein zentrales CBAM-Register, das die EU einführt.
Wie hoch sind die Kosten für CBAM-Zertifikate ab 2026
Die Kosten für CBAM-Zertifikate hängen unmittelbar am Preis im EU-Emissionshandel (EU-ETS). Wenn dort ein Zertifikat 80 Euro pro Tonne CO₂ kostet, musst Du auch 80 Euro für ein CBAM-Zertifikat zahlen.
–
Das kann teuer werden. Ein Beispiel: Importiert Euer Unternehmen 100 Tonnen Stahl, bei dessen Produktion pro Tonne zwei Tonnen CO₂ ausgestoßen wurden, ergibt das 200 Tonnen CO₂. Bei einem Preis von 80 Euro pro Tonne sind das 16.000 Euro allein für CBAM. Wenn im Herkunftsland bereits CO₂-Kosten angefallen sind, kannst Du diese zwar abziehen, aber nur, wenn Du entsprechende Nachweise von Deinen Lieferanten erhalten hast.
–
Für Euer Unternehmen bedeutet das: Ab 2026 wird Importieren deutlich teurer, wenn es sich um emissionsintensive Produkte handelt. Es lohnt sich, schon jetzt Strategien zu entwickeln, um diese Kosten zu reduzieren – sei es durch andere Lieferketten, durch genauere Nachweise oder durch eine Umstellung auf klimafreundlichere Produkte.
Wer ist für CBAM zuständig?
Die EU-Kommission hat CBAM auf den Weg gebracht und koordiniert das System. In Deutschland übernimmt die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt die Umsetzung. Zusätzlich sind die Zollbehörden beteiligt, die die Einfuhr überwachen und den Kontakt zu den Unternehmen sicherstellen.
–
Ab 2026 wird das zentrale CBAM-Register eingeführt. Dort musst Du Euer Unternehmen registrieren, Zertifikate kaufen und Eure Pflichten nachweisen.
–
Für Dich heißt das: Du wirst es mit mehreren Behörden zu tun haben – auf EU-Ebene, mit der DEHSt und mit dem Zoll.
Welche Länder sind von CBAM ausgenommen?
CBAM gilt nur für Importe aus Ländern, die kein vergleichbares CO₂-Bepreisungssystem haben. Ausgenommen sind alle Länder, die am EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) teilnehmen oder ihr eigenes System damit verknüpft haben. Dazu gehören neben den EU-Mitgliedstaaten auch Norwegen, Island, Liechtenstein sowie die Schweiz. Diese Länder gelten als gleichwertig im Sinne der CBAM-Verordnung.
–
Importiert Euer Unternehmen also Waren aus Norwegen oder der Schweiz, bist Du von CBAM nicht betroffen. Bei Importen aus Ländern wie China, Indien oder der Türkei dagegen musst Du CBAM einhalten und die Zertifikate erwerben.
CBAM-Omnibus
Mit dem sogenannten „Omnibus I“-Paket hat die EU im September 2025 wichtige Vereinfachungen am CBAM beschlossen. Nach der Zustimmung von Parlament und Rat wurde die Einigung im EU-Amtsblatt veröffentlicht – die neuen Bestimmungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft. Ziel ist es, die Umsetzung des CO₂-Grenzausgleichssystems für Unternehmen praxisnäher und administrativ einfacher zu gestalten.
–
Die wichtigsten Änderungen im Überblick
- Neuer Schwellenwert: Anstelle der bisherigen Warenwertgrenze von 150 Euro pro Sendung gilt künftig eine mengenbasierte Ausnahme. Importe bis zu 50 Tonnen CBAM-Waren pro Importeur und Jahr sind von den Berichtspflichten befreit. Laut EU-Angaben profitieren dadurch rund 90 % der Importeure – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen – während weiterhin 99 % der relevanten Emissionen im System erfasst bleiben.
- Vereinfachte Verfahren für größere Importeure: Für Unternehmen oberhalb dieser Grenze werden die Abläufe deutlich vereinfacht – insbesondere bei der Zulassung als CBAM-Anmelder, der Berechnung der Emissionen, der Überprüfungspflichten und der finanziellen Haftung.
Neu ist die Möglichkeit, zwischen Standardwerten und realen Emissionsdaten zu wählen. Wird mit Standardwerten gearbeitet, entfällt die externe Verifizierung; eine unabhängige Prüfung ist nur erforderlich, wenn reale Werte gemeldet werden. - Zulassungspflicht ab 2026: Ab 1. Januar 2026 dürfen CBAM-pflichtige Waren nur noch von zugelassenen CBAM-Anmeldern importiert werden. Der Antrag im zentralen CBAM-Register sollte frühzeitig gestellt werden, da der Zulassungsprozess mehrere Wochen dauern kann.
Kann Grubengold mir mit CBAM helfen?
Klar! CBAM ist komplex und die Regeln ändern sich laufend. Wir bei Grubengold helfen Euch herauszufinden, ob Ihr betroffen seid und zeigen, wie Ihr die CBAM-Berichte korrekt erstellt. Wir bauen gemeinsam mit Euch Prozesse auf, damit Ihr alle Daten im Griff habt und analysieren, welche Kosten auf Euch zukommen könnten. Außerdem entwickeln wir Strategien, wie Ihr CBAM nicht nur erfüllt, sondern sogar als Chance nutzt, Eure Lieferketten nachhaltiger und zukunftssicher zu machen.
–
CBAM ist das neue Werkzeug der EU, um Klimaschutz und fairen Wettbewerb zu verbinden. Für Euer Unternehmen bedeutet das: Wenn Ihr CO₂-intensive Produkte in die EU importiert, müsst Ihr Euch spätestens ab 2026 auf zusätzliche Kosten einstellen. Die Übergangsphase bis Ende 2025 gibt Euch die Möglichkeit, die nötigen Prozesse aufzubauen und Erfahrungen zu sammeln.
–
Mit der richtigen Strategie könnt Ihr CBAM aber nicht nur als Pflicht sehen, sondern als Möglichkeit, Eure Lieferketten klimafreundlicher und Euer Unternehmen zukunftssicherer aufzustellen. Und genau dabei stehen wir von Grubengold an Eurer Seite.
Unser Experte

David Hannes
David unterstützt Unternehmen u. a. bei den Themen CO₂-Bilanzen und nachhaltige Geschäftsmodell-Transformation. Mit seinem naturwissenschaftlichen Hintergrund als Medizinphysiker – inklusive eines Auslandssemesters am MIT – bringt er analytische Tiefe und systemisches Denken in die Entwicklung von Klimastrategien ein. Bei Grubengold berät er Unternehmen dabei, Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu bilanzieren, zu verstehen und wirkungsvoll zu reduzieren.